Gastbeitrag von Peter Scheller
Die aktuelle „Mitte-Studie“ der Universität Bielefeld und der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) zeichnet das Bild einer „angespannten Mitte“: Rechtsextreme Einstellungen gingen zwar zurück, aber antidemokratische Haltungen verfestigten sich. Ein großer „Graubereich“ in der Bevölkerung sei offen für autoritäre und menschenfeindliche Positionen.
Gerade weil die Studie inzwischen in der politischen Debatte und der medialen Berichterstattung als Referenz dient, lohnt ein genauerer Blick: Was misst sie tatsächlich? Welche blinden Flecken hat sie? Und inwieweit sind die politischen Rahmenbedingungen – inklusive der Rolle der etablierten Parteien – Teil des Problems, das sie beschreibt?
Was behauptet die Studie?
Die Studie beruht auf einer repräsentativen Befragung von rund 2000 Personen in Deutschland. Abgefragt wurden Einstellungen zu Demokratie und politischen Institutionen, rechtsextremen und nationalchauvinistischen Positionen, gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit (z. B. gegenüber Geflüchteten, Langzeitarbeitslosen, Transpersonen) sowie zu einer neu eingeführten Kategorie einer „libertär-autoritären Ideologie“.
Zentrale Befunde der Studie sind folgende: Nur noch rund 3,3 % der Befragten weisen ein „klar rechtsextremes Weltbild“ auf, also eine Kombination aus Diktaturbefürwortung, NS-Verharmlosung und völkischem Nationalismus. Gleichzeitig befinde sich etwa ein Fünftel der Bevölkerung in einem „Graubereich“, der zu Teilen rechtsextremen Aussagen zustimmt oder ambivalent reagiert. Das Vertrauen in demokratische Institutionen sei deutlich gesunken; nur gut die Hälfte der Befragten meine noch, die Demokratie funktioniere „im Großen und Ganzen gut“.
Die Diagnose lautet deshalb: Die demokratische Mitte sei „angespannt“, Rechtsextremismus dringe in einen „Graubereich“ vor. Politisch wird das als Beleg für wachsende Gefahren „von rechts“ interpretiert.
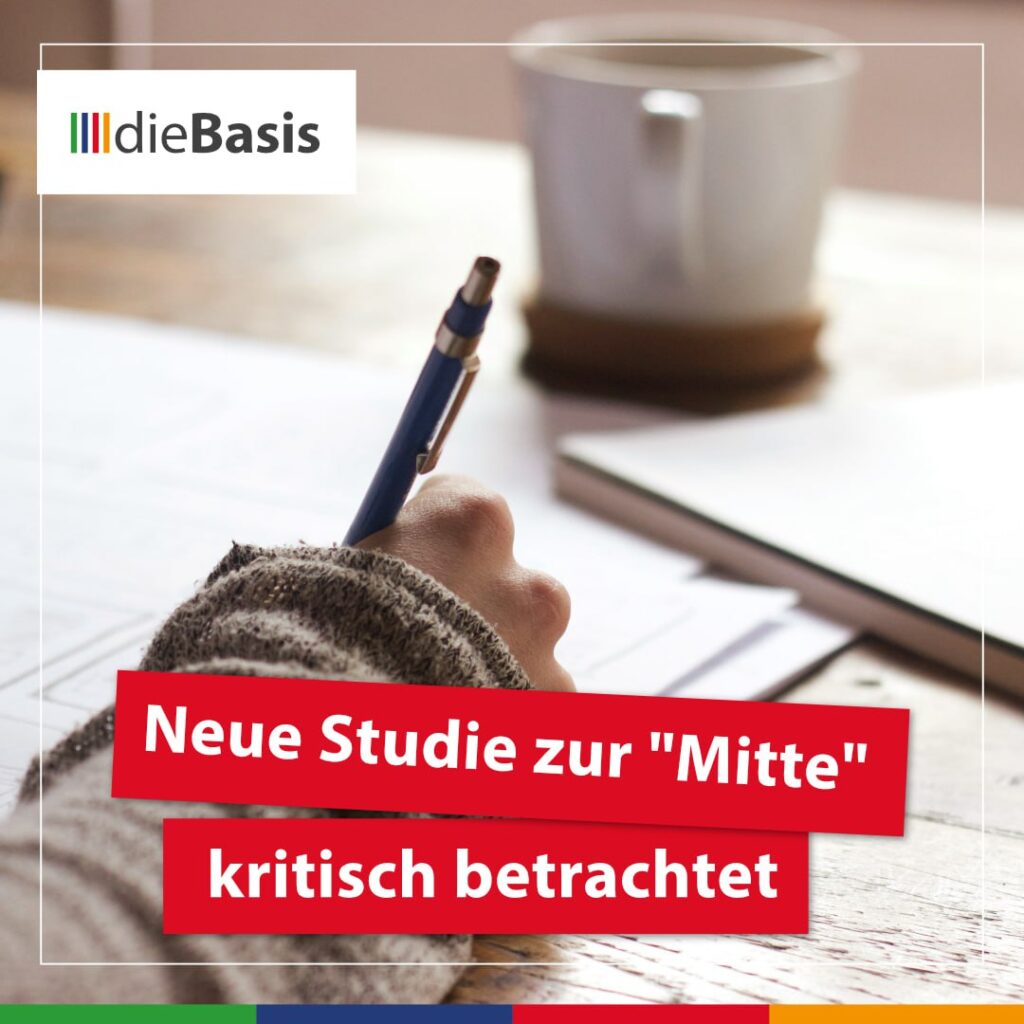
Kann eine parteinahe Stiftung wirklich eine unabhängige Analyse durchführen?
Die Studie wird von der Friedrich-Ebert-Stiftung herausgegeben, die sich selbst als parteinahe Stiftung zur Sozialdemokratie versteht. Ihre eigenen Selbstdarstellungen betonen ausdrücklich die Bindung an die Werte der „sozialen Demokratie“, die gewachsene Nähe zur SPD und zur Gewerkschaftsbewegung.
Diese Nähe ist nicht bloß ein weicher Imagefaktor, sondern verfassungsrechtlich relevant. Das Bundesverfassungsgericht hat 2023 in seiner Grundsatzentscheidung zu parteinahen Stiftungen (Az. 2 BvE 3/19) klargestellt, dass die staatliche Förderung solcher Stiftungen die Chancengleichheit der Parteien im politischen Wettbewerb berührt. Weil parteinahe Stiftungen auf die politische Willensbildung der Bürger einwirken, darf ihre Finanzierung nicht im rechtsfreien Raum erfolgen, sondern bedarf einer spezifischen gesetzlichen Grundlage.
Wenn eine solche Stiftung eine groß angelegte und medial weit verbreitete Studie zur „Mitte“ der Gesellschaft vorlegt, ist Folgendes klar: Es liegt keine rein akademisch basierte Studie vor, sondern ein Instrument politischer Öffentlichkeitsarbeit. Selbst wenn man das als legitim ansieht, enthält es ein normatives Framing. Der Fokus auf „Gefahr von rechts“, die verwendeten Begriffe und die politische Lesart der Ergebnisse sind nicht neutral, sondern spiegeln ein sozialdemokratisches und linksliberales Politikverständnis.
Das heißt nicht, dass die Daten manipuliert wären. Aber es bedeutet, dass schon die Auswahl der Fragethemen, die Konstruktion der Skalen und die Interpretation der Ergebnisse in einem politischen Kontext stehen.
Die ausgeblendete Seite – Linksextremismus als blinder Fleck
Die „Mitte-Studie“ trägt im Untertitel den Anspruch: „rechtsextreme und demokratiegefährdende Einstellungen“ in Deutschland. Inhaltlich ist sie nahezu vollständig auf Rechtsextremismus und rechtspopulistische Segmente konzentriert. Linke Formen der Demokratiefeindlichkeit, das Vorliegen linksextremer Gewalt und systemfeindlicher Positionen werden empirisch nicht erhoben.
Dass dies kein Randphänomen ist, zeigen offizielle Sicherheitsberichte. Der Verfassungsschutzbericht 2024 weist ein linksextremistisches Personenpotenzial von rund 38 000 Personen aus, darunter unverändert etwa 11 200 gewaltorientierte Linksextremisten. Die Zahl der linksextremistisch motivierten Straftaten ist 2024 um knapp 38 % auf 5.857 Delikte gestiegen.
Parallel dazu betont das Bundesamt für Verfassungsschutz, dass Rechtsextremismus zwar weiterhin die größte Bedrohung für die freiheitliche demokratische Grundordnung darstellt, linksextreme Gewalt aber ebenfalls erheblich zur Destabilisierung des demokratischen Systems beitragen kann.
Vor diesem Hintergrund wirkt der alleinige Blick der Studie auf rechte Gefährdungen analytisch einseitig. Wer mit großem Anspruch „demokratiegefährdende Einstellungen“ in der Mitte der Gesellschaft erheben will, aber nur nach rechts schaut, lässt die andere ideologische Flanke systematisch aus. Das erzeugt zwangsläufig den Eindruck, Demokratie sei nur „von rechts“ bedroht und verstärkt die politische Schlagseite der Studie.
Der „Graubereich“ – methodisch problematisch und politisch aufgeladen
Besonders heikel ist der Umgang mit dem sogenannten „Graubereich“. Die Befragten antworteten auf einer fünfstufigen Zustimmungsskala. Neben klarer Zustimmung und klarer Ablehnung gibt es die mittlere Kategorie „teils/teils“. In der öffentlichen Darstellung wird nun ein größerer Anteil der Bevölkerung, der diese mittleren bzw. ambivalenten Antwortkategorien wählte, als „Graubereich“ beschrieben, der für rechtsextreme und demokratiegefährdende Einstellungen offen sei.
Damit werden sehr unterschiedliche Gründe für solche Antworten als rechts geframt. Gründe könnten beispielsweise echte Ambivalenz, differenzierte Positionen zu den abgefragten Themen, Unentschlossenheit, Unbehagen in der aktuellen politischen Lage oder einfach nur ein Nichtverstehen der jeweiligen Frage sein. Problematisch wird es dort, wo aus dieser Mehrdeutigkeit eine wertende Beurteilung, nämlich „offen für Rechtsextremismus“, gemacht wird.
Genau hier setzt die Kritik an. In mehreren Kommentaren wird der Studie vorgeworfen, bürgerliche und konservative Positionen in die Nähe des Rechtsextremismus zu rücken und die gesellschaftliche Mitte zu „pathologisieren“. Es wird von einem „perfiden Trick“ gesprochen, bei dem schon eine moderate oder differenziert formulierte Kritik an Migration, Sozialpolitik oder Kriminalität als Teil einer rechtsextremen Gefahrenzone umgedeutet wird.
Wenn die mittlere Antwortkategorie definitionsgemäß als „problematisch“ gesehen wird, dann gerät jede Art von vorsichtigem, nuanciertem oder nicht eindeutig zustimmendem Antwortverhalten unter Verdacht. Damit verwischt die Grenze zwischen legitimer System- oder Regierungskritik und echter Demokratiefeindlichkeit.
Damit verschiebt sich die Wahrnehmung. Ambivalente Einstellungen, die nach rechts tendieren, gelten schnell als „demokratiegefährdend“, während andere Formen von Ambivalenz (etwa bei linkem Radikalismus) mangels Erfassung gar nicht als Problem erscheinen. Für eine wissenschaftliche Studie ist das bedenklich. Es besteht die Gefahr, dass der Begriff „Graubereich“ zu einem pauschalen Verdachtslabel für große Teile der Bevölkerung wird.
Demokratie in der Vertrauenskrise – die Rolle der etablierten Parteien
Ein weiterer Punkt, den die Studie anspricht, aber nicht konsequent zu Ende untersucht, sind die Ursachen der beschriebenen Entfremdung der Bevölkerung von ihren politischen Repräsentanten. Sie dokumentiert sinkendes Vertrauen in Institutionen und verbreitetes Misstrauen gegenüber „denen da oben“. Die Frage, wer dieses Vertrauen verspielt hat, wird jedoch nicht untersucht.
Hier lohnt der Blick auf unabhängige Daten. Die OECD hat 2023/24 im Rahmen ihrer Vergleichsstudie zur Vertrauenslage detaillierte Zahlen vorgelegt. In der Länderauswertung für Deutschland zeigt sich, dass politische Parteien das Schlusslicht bilden. Nur 26 % der Bevölkerung geben an, hohes oder mittleres Vertrauen in Parteien zu haben. Für den Bundestag liegt der Wert bei 35 %, für Nachrichtenmedien bei 34 %. Damit ist das Vertrauen deutlich niedriger als etwa in Verwaltung oder Polizei.
Die OECD betont zudem, dass mangelndes Vertrauen in Institutionen in der Regel nicht auf eine generelle Ablehnung demokratischer Werte zurückgeht, sondern auf wahrgenommene Defizite bei Leistungsfähigkeit, Fairness und Integrität der politischen Akteure. Vertrauensverluste entstehen dort, wo Menschen das Gefühl haben, die Politik reagiere nicht auf ihre Lebenswirklichkeit, handle inkonsistent oder verletze grundlegende Erwartungen an Rechtsstaatlichkeit und Transparenz.
Wer diese Erkenntnisse mit den Befunden der „Mitte-Studie“ kombiniert, kommt an folgender Schlussfolgerung nicht vorbei: Die beschriebenen demokratiegefährdenden Einstellungen fallen nicht vom Himmel. Sie wachsen in einem Klima, in dem große Teile der Bevölkerung das Vertrauen in etablierte Parteien, Parlamente und Regierungen verloren haben. Dieses Klima ist Ergebnis der Politik dieser Parteien, beispielsweise des Umgangs mit den Krisen, innerkoalitionärer Dauerstreitigkeiten oder widersprüchlicher Kommunikation.
Dass populistische Akteure diese Vertrauenslücke ausnutzen, ist nicht zu bestreiten. Aber wer nur auf deren Agitation schaut, ohne die Mitverantwortung der etablierten Kräfte für die Entstehung dieses Befundes zu thematisieren, greift zu kurz. Die „Mitte-Studie“ beschreibt die Symptome – einen Teil der Ursachen überlässt sie weitgehend der Interpretation.
Einordnung der Studie
Man sollte sich bewusst sein, dass die Studie von einer parteinahen Stiftung verantwortet wird, die mit einem klaren politischen Auftrag arbeitet. Das normative Framing, wie die Beschwörung der Gefahr „von rechts“, und die Einseitigkeit der Studie gehören zum Gesamtpaket. Die fehlende empirische Erfassung linksextremer und anderer antidemokratischer Haltungen relativiert den Anspruch, ein umfassendes Bild demokratiegefährdender Einstellungsmuster zu liefern.
Den „Graubereich“ als Sammelschublade für Ambivalenz, Skepsis oder regierungskritisches Unbehagen zu deuten, mag richtig sein. Daraus zu schließen, ein Fünftel der Bevölkerung sei im Grunde schon „halb rechts“, trägt eher zur weiteren Polarisierung und Entfremdung und damit zur weiteren Spaltung der Gesellschaft bei. Dies kann nicht zur Stärkung der Demokratie führen, sondern untergräbt nur die Glaubwürdigkeit in den politischen Willen, diese tatsächlich schützen zu wollen.
Die Verantwortung der „Parteien der Mitte“ für eine sich zersetzende Demokratie wird letztendlich negiert. Eine Studie, die Bürger pauschal unter Generalverdacht setzt, latent antidemokratisch zu sein, nur weil sie „teils/teils“ antworten, ist unverantwortlich.
Quellenverzeichnis:
Friedrich-Ebert-Stiftung (Hg.): Die angespannte Mitte – Rechtsextreme und demokratiegefährdende Einstellungen in Deutschland 2024/25 – https://www.fes.de/mitte-studie
OECD Survey on Drivers of Trust in Public Institutions – 2024 Result – https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/11/lack-of-trust-in-institutions-and-political-engagement_ae8a8673/83351a47-en.pdf
Bundesamt für Verfassungsschutz / Bundesministerium des Innern, Verfassungsschutzbericht 2024 und Online-Daten „Zahlen und Fakten: Linksextremismus“ – https://www.verfassungsschutz.de/SharedDocs/publikationen/DE/verfassungsschutzberichte/2025-06-10-verfassungsschutzbericht-2024.pdf
Analyse „Mitte-Studie: Rechtsextremismus im Graubereich – und die fragwürdige Methodik dahinter“ – https://www.welt.de/politik/deutschland/plus690ca5744b8e9e8a831706a0/mitte-studie-rechtsextremismus-im-graubereich-und-die-fragwuerdige-methodik-dahinter.html