Gastbeitrag von Ralph Schöpke und Peter Scheller (KI-unterstützt)
Der Mensch ist kulturell anpassungsfähig wie kaum ein anderes Wesen. Nach der Geburt lernt unser Gehirn im „Autopilot“: Wir testen nach, wir ahmen nach, wir ordnen Erfahrungen ein. Aus dieser frühen Selbstorganisation entsteht, was uns später im Miteinander trägt – Empathie, Gerechtigkeitssinn, Sprach- und Konfliktfähigkeit. Genau deshalb entscheidet Erziehungspolitik darüber, ob eine Gesellschaft mündig und frei wird – oder formbar für Angst, Druck und Gehorsam.
Wenn Belohnung und Strafe Politik ersetzen
„Schwarze Pädagogik“ meint eine Praxis, die Verhalten durch Belohnung und Bestrafung konditioniert, statt Einsicht, Urteilskraft und Verantwortung zu stärken. Übertragen in die politische Sphäre zeigt sie sich, wenn Bürgerinnen und Bürger über Etiketten und Drohkulissen gesteuert werden: Wer abweicht, gilt rasch als unsolidarisch; wer fragt, als Querulant. Der öffentliche Raum schrumpft, wenn Menschen lernen, nicht mehr zu begründen, sondern zu gehorchen. Kurzfristig mag das Entscheidungen beschleunigen. Langfristig untergräbt es das Fundament der Demokratie: die Fähigkeit, Argumente zu prüfen, Interessen abzuwägen und gemeinsam neue Lösungen zu entwickeln.
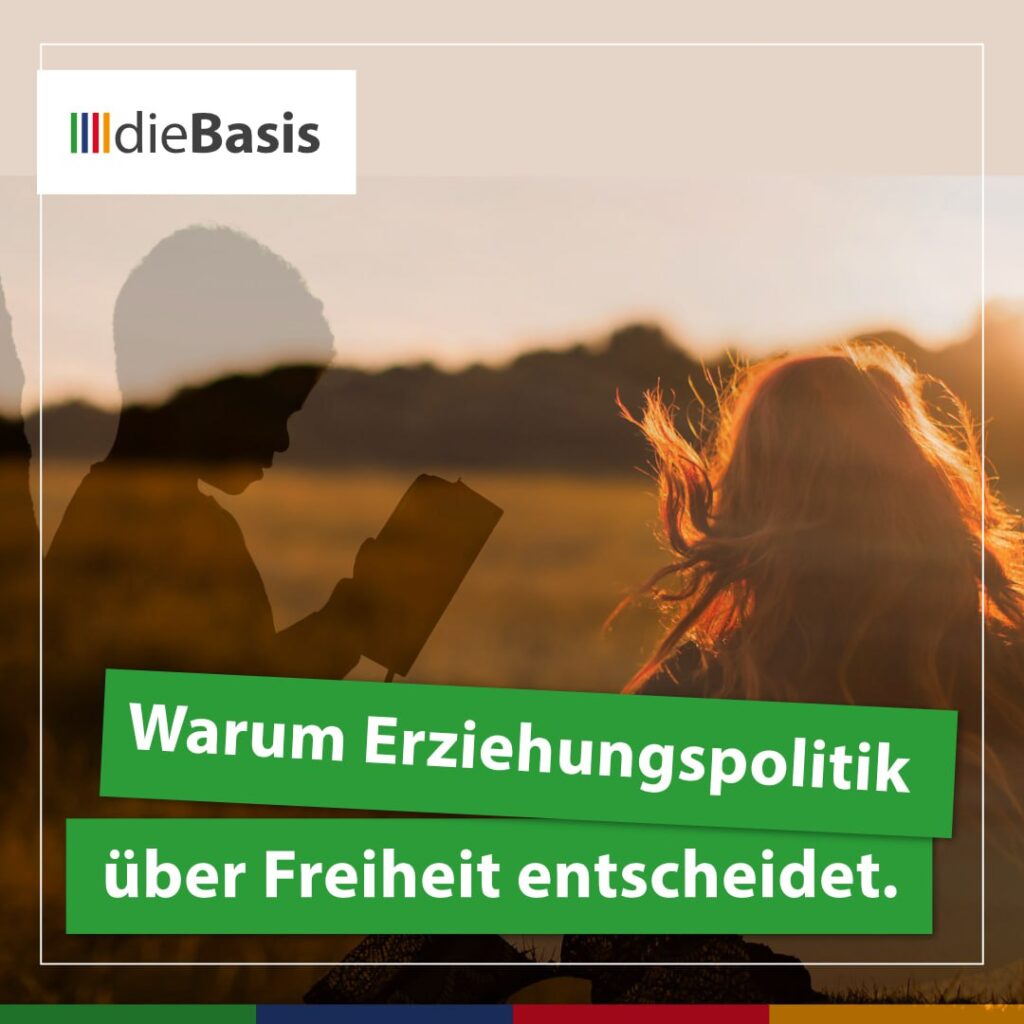
Bildungspolitik als Sicherheitsfrage
Frühkindliche Erfahrungen prägen unser Empathievermögen. Wo Familien und Bildungseinrichtungen chronisch unterfinanziert sind, wachsen Traumatisierungen und Perspektivlosigkeit – mit spürbaren Folgen von Aggression bis Zynismus. Wer bei den Jüngsten spart, zahlt später gesellschaftlich und wirtschaftlich einen hohen Preis. Eine demokratische Gesellschaft muss daher in stabile Beziehungen, qualifizierte Pädagogik und echte Teilhabe investieren. Es ist kein Luxus, wenn Kinder lernen, Gefühle zu benennen, Konflikte fair zu lösen und Verantwortung zu übernehmen – es ist Daseinsvorsorge.
dieBasis: Vier Säulen gegen autoritäre Versuchungen
dieBasis steht für Freiheit, Machtbegrenzung, Achtsamkeit und Schwarmintelligenz. Übersetzt in Bildungs- und Gesellschaftspolitik heißt das: Wir setzen auf Rechte statt auf Rituale des Gehorsams, auf transparente Verfahren statt auf informelle Drohkulissen, auf einen respektvollen Ton, der Menschen einlädt, statt sie zu stigmatisieren, und auf Beteiligungsformate, in denen viele Perspektiven zu besseren Entscheidungen führen. Wer Menschen ernst nimmt, braucht keine dressierenden Frames. Er liefert Begründungen, eröffnet Alternativen und akzeptiert, dass Widerspruch zur Demokratie gehört.
Von der Dressur zur Dialogkultur
Wie kommen wir weg von der Konditionierung hin zu Reife und Selbstbestimmung? Erstens, indem staatliche Kommunikation die Bürgerinnen und Bürger als Souverän adressiert: klare Ziele, offene Belege, nachvollziehbare Abwägungen. Zweitens, indem Schulen und Kitas Zeit für Beziehung, Projektlernen und Medienkompetenz bekommen – nicht nur für Prüfungsformate. Drittens, indem Kommunen Räume fördern, in denen Nachbarschaften über Streitfragen sprechen, ohne sich wechselseitig zu etikettieren. Demokratie ist eine Übungssache: Wer Beteiligung erlebt, lässt sich weniger leicht durch Angst- und Belohnungsschemata steuern.
Was die Öffentlichkeit davon hat
Eine Gesellschaft, die in Urteilsfähigkeit statt Gehorsam investiert, wird widerstandsfähiger gegen populistische Vereinfachungen und autoritäre Reflexe. Sie löst Konflikte früher, bevor sie eskalieren – in Familien, Schulen, Betrieben und Verwaltungen. Sie spart Kosten, weil Prävention billiger ist als Reparatur. Vor allem aber gewinnt sie Vertrauen zurück: Entscheidungen, die sichtbar fair und begründet zustande kommen, werden auch dann akzeptiert, wenn sie unbequem sind.
Unsere Einladung
dieBasis versteht Politik als gemeinsame Lernbewegung. „Schwarze Pädagogik fürs Volk“ – also konditionierende Angst und Dressur – ist das Gegenteil dessen, was eine lebendige Demokratie braucht. Wir laden alle ein, die sich eine Kultur des Respekts, der Transparenz und der Mitgestaltung wünschen: Bringen Sie Ihre Erfahrung ein, stellen Sie Fragen, widersprechen Sie und helfen Sie mit, damit aus Erziehung zur Mündigkeit gelebte Freiheit wird. Nur so bleibt Politik das, was sie sein soll: Sache der Bürgerinnen und Bürger.
Quellen:
Senske, F. (2023): Kommen Wahrheiten zur Welt. Evolution Zufall Bedeutung Ohnmacht des Bewusstseins. tredition; ISBN 978-3-347-95141-9.
Maaz, H.-J. (2024): Friedensfähigkeit und Kriegslust; Frank & Timme GmbH Berlin.