Gastbeitrag von Robert Barkholz
Das Bundesverwaltungsgericht knüpft die Beitragspflicht erstmals an den Programmauftrag. Wie Bürger eine grobe Verfehlung der Sender jetzt nachweisen können. Ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig mit dem Aktenzeichen 6C524 sorgt für ein juristisches Beben in der deutschen Medienlandschaft.
Erstmals hat das höchste deutsche Verwaltungsgericht klargestellt: Die Pflicht zur Zahlung des Rundfunkbeitrags ist kein Blankoscheck, sondern an die Erfüllung des gesetzlichen Programmauftrags gebunden. Dieser umfasst Vielfalt, Ausgewogenheit und Staatsferne. Für Beitragszahler, die dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk schon lange Einseitigkeit vorwerfen, öffnet sich damit eine neue Tür. Doch das Gericht legte die Hürden hoch.
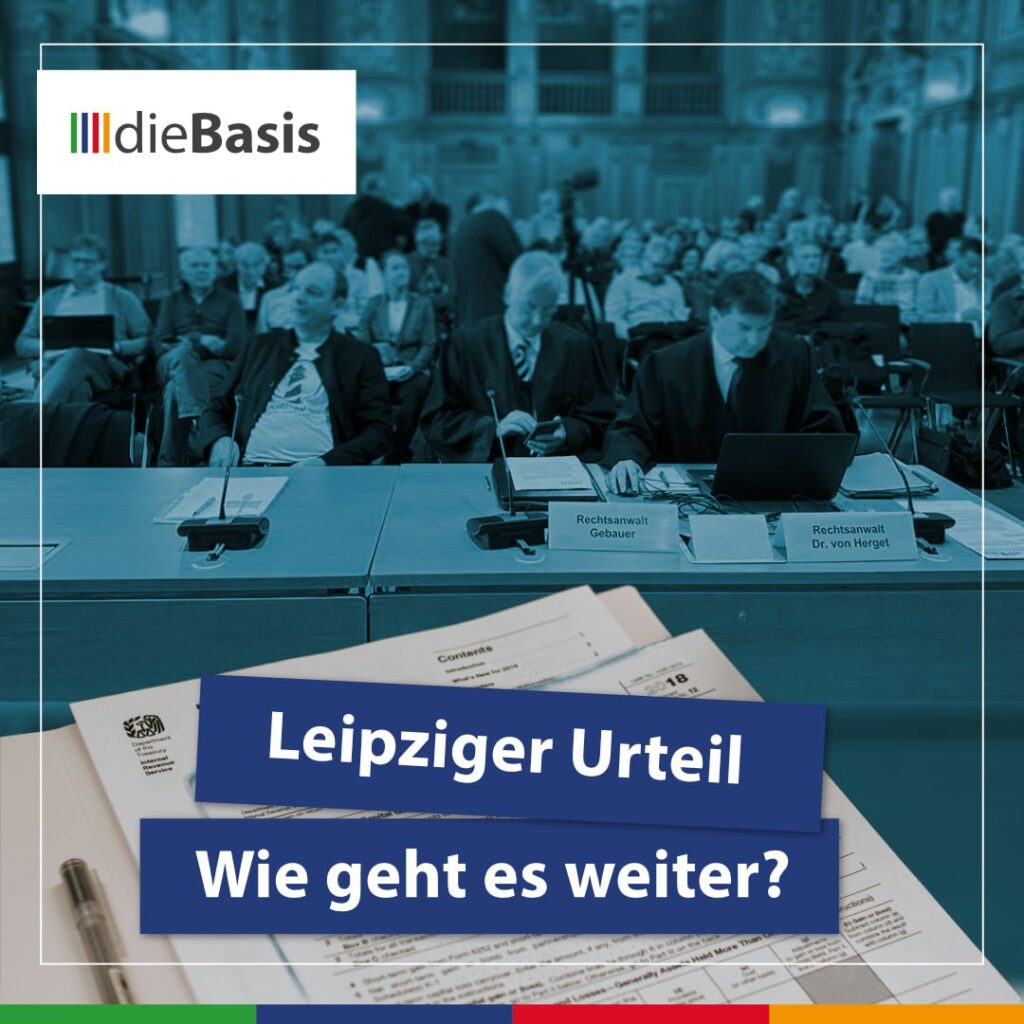
Das Urteil bedeutet Schluss mit dem sogenannten Testbild-Argument
Jahrzehntelang war die Argumentation der Sender und unteren Gerichte einfach: Wer ein Gerät besitzt, das theoretisch empfangen kann, muss zahlen – selbst wenn die Sender nur ein Testbild ausstrahlen würden. Mit dieser sogenannten Testbildtheorie hat der sechste Senat in Leipzig nun aufgeräumt. Die Richter stellten klar, dass der Rundfunkbeitrag an eine Gegenleistung gebunden ist, nämlich an die Erfüllung des Funktionsauftrags. Sollten die Sender diesen Auftrag grob und über einen längeren Zeitraum verfehlen, könnte die Beitragserhebung verfassungswidrig sein. Der entscheidende Punkt: Die Gerichte müssen sich jetzt mit substantiiert vorgetragenen Beweisen zur Programmqualität auseinandersetzen. Sie dürfen Klagen nicht mehr pauschal abweisen.
Experten sehen in dem Urteil eine Wende. In einem viel beachteten Video mit dem Titel „Alarmstufe Rot beim Rundfunk“ analysiert der Wirtschaftsprofessor Christian Rieck die Tragweite der Entscheidung. Er und seine Gesprächspartner bezeichnen das Urteil als Wendepunkt. Das Gericht verlange zwar hohe Hürden, Kläger müssten die grobe Verfehlung nachweisen, doch diese Hürden seien, so die Analyse, nicht unüberwindbar. Der Grund: Die notwendigen Beweise existieren bereits. Bürger müssen die Einseitigkeit nicht selbst per Strichliste nachweisen, sondern können auf vorhandene wissenschaftliche Daten zurückgreifen.
Wie aber weist man Einseitigkeit objektiv nach?
Die Antwort liegt in der wissenschaftlichen Medieninhaltsanalyse. Diese Methode, die an Universitäten und in der Medienforschung seit Jahrzehnten genutzt wird, macht mediale Inhalte messbar. Eine solche Analyse funktioniert im Kern so: Zuerst wird gezählt, wie oft über bestimmte Themen berichtet wird, zum Beispiel über Industriepolitik im Vergleich zu Ordnungspolitik oder über verschiedene Experten.
Zweitens wird bewertet, ob die Berichterstattung positiv, negativ oder neutral ausfällt. Und drittens wird geprüft, welche Themen von den Sendern prominent platziert werden und welche systematisch fehlen – also welche Themen auf die Agenda gesetzt werden und welche nicht. Durch diese quantitative und qualitative Erfassung wird aus einem subjektiven Bauchgefühl der Einseitigkeit ein objektiver, statistischer Datensatz. Genau solche Daten sammelt das Schweizer Forschungsinstitut Media Tenor International. Wie in mehreren Expertenanalysen bestätigt wird, führt dieses Institut seit Jahrzehnten tägliche Inhaltsanalysen der wichtigsten Medien durch, einschließlich ARD und ZDF.
Media Tenor verfügt damit über einen umfangreichen Datenbestand, der genau jene strukturellen Defizite belegen kann, die das Gericht jetzt als Beweisgrundlage anerkennt. Zum Beispiel die unausgewogene Expertenauswahl während der Corona-Pandemie oder die Schlagseite in der Wirtschaftsberichterstattung. Doch wie bringt man diese Daten vor Gericht? Hier liegt die entscheidende Hürde für Kläger. Es reicht nicht, dem Gericht einen Link zur Webseite von Media Tenor oder ein YouTube Video zu schicken.
Die Daten müssen so aufbereitet werden, dass sie als gerichtsfestes Beweismittel gelten. Ein Kläger oder besser gesagt dessen Anwalt muss dazu einen klaren Weg gehen. Erstens: Die Daten müssen offiziell erworben oder lizenziert werden. Media Tenor stellt keine kostenlosen Downloads bereit, sondern verkauft wissenschaftliche Datensätze und Analysen als Dienstleistung. Zweitens: Diese Daten müssen in Form eines Gutachtens aufbereitet werden.
Das bedeutet, Tabellen, Grafiken und Zeitreihen werden wissenschaftlich und juristisch so aufbereitet, dass sie den Anforderungen eines Gerichts entsprechen. Drittens: Der Anwalt muss in der Klage genau darlegen, warum diese Daten eine grobe Verfehlung im Sinne des Leipziger Urteils belegen. Zum Beispiel: Wenn über zwei Jahre hinweg neunzig Prozent der Sendezeit einer Position gewidmet werden, während eine Gegenposition nur fünf Prozent erhält, kann das ein massives Missverhältnis darstellen. Nur wenn die Daten als fundiertes, wissenschaftliches Gutachten eingereicht werden, erfüllen sie die Anforderungen des Gerichts.
Wie geht es weiter?
Das Bundesverwaltungsgericht hat den Klägern damit zwar keine einfache Aufgabe gestellt, aber eine Möglichkeit eröffnet: Wer nachweisen kann, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk seinen gesetzlichen Auftrag über längere Zeit grob verfehlt hat, kann die Beitragspflicht grundsätzlich infrage stellen. Das Urteil verpflichtet zugleich die Gerichte, solche Nachweise ernsthaft zu prüfen.
Damit ist die Zeit vorbei, in der Klagen gegen den Rundfunkbeitrag mit einem Standardsatz abgewiesen werden konnten. Ab jetzt müssen Richter sich mit der inhaltlichen Qualität der Programme auseinandersetzen, wenn sie gut begründete Beweise auf den Tisch bekommen. Das Leipziger Urteil markiert damit eine Wende in der Beziehung zwischen Bürger und Rundfunk. Es verwandelt das diffuse Gefühl vieler Menschen, dass im Programm etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist, in eine juristisch greifbare Möglichkeit zur Überprüfung. Vom Bauchgefühl zur gerichtsfesten Klage, so könnte man diese Entscheidung zusammenfassen.