Polen – Deutschland – Russland
Der FOCUS-Online-Artikel „Historische Ängste treiben Polens Politik“ behauptet, Polens Sicherheitsdenken sei vor allem durch „Jahrhunderte russischer Besatzung“ geprägt. Das ist nicht falsch, aber es ist unvollständig. – Eine Einordnung.
Gastbeitrag von Peter Scheller

Historische Ängste treiben Polens Politik
Die Geschichte spielt eine wichtige Rolle in Polens Sicherheitsstrategie: Das Land hat über Jahrhunderte unter russischer Besatzung gelitten, zuletzt während des Kalten Krieges. Diese Erfahrungen prägen das Denken der polnischen Führung bis heute.
„Das ist unser Krieg“, sagte Tusk dazu. Polen wolle nicht noch einmal unvorbereitet sein und habe deshalb die Modernisierung seiner Armee massiv vorangetrieben.
Quelle: Focus online
Framing durch Weglassen: Wenn Geschichte zur Kulisse wird
Der FOCUS-Online-Artikel „Historische Ängste treiben Polens Politik“ behauptet, Polens Sicherheitsdenken sei vor allem durch „Jahrhunderte russischer Besatzung“ geprägt. Das ist nicht falsch, aber es ist unvollständig. Polens historische Erfahrung ist komplexer. Über Jahrhunderte herrschten abwechselnd Russland, Preußen bzw. Deutschland und Österreich über das polnische Territorium. Im 20. Jahrhundert trafen Polen besonders die deutsche Besatzung von 1939 bis 1945 und in Ostpolen die sowjetische Herrschaft von 1939 bis 1941 und nach 1944. Wer nur die russische Seite betont, verschiebt den Blick und erzeugt ein verzerrtes Feindbild.
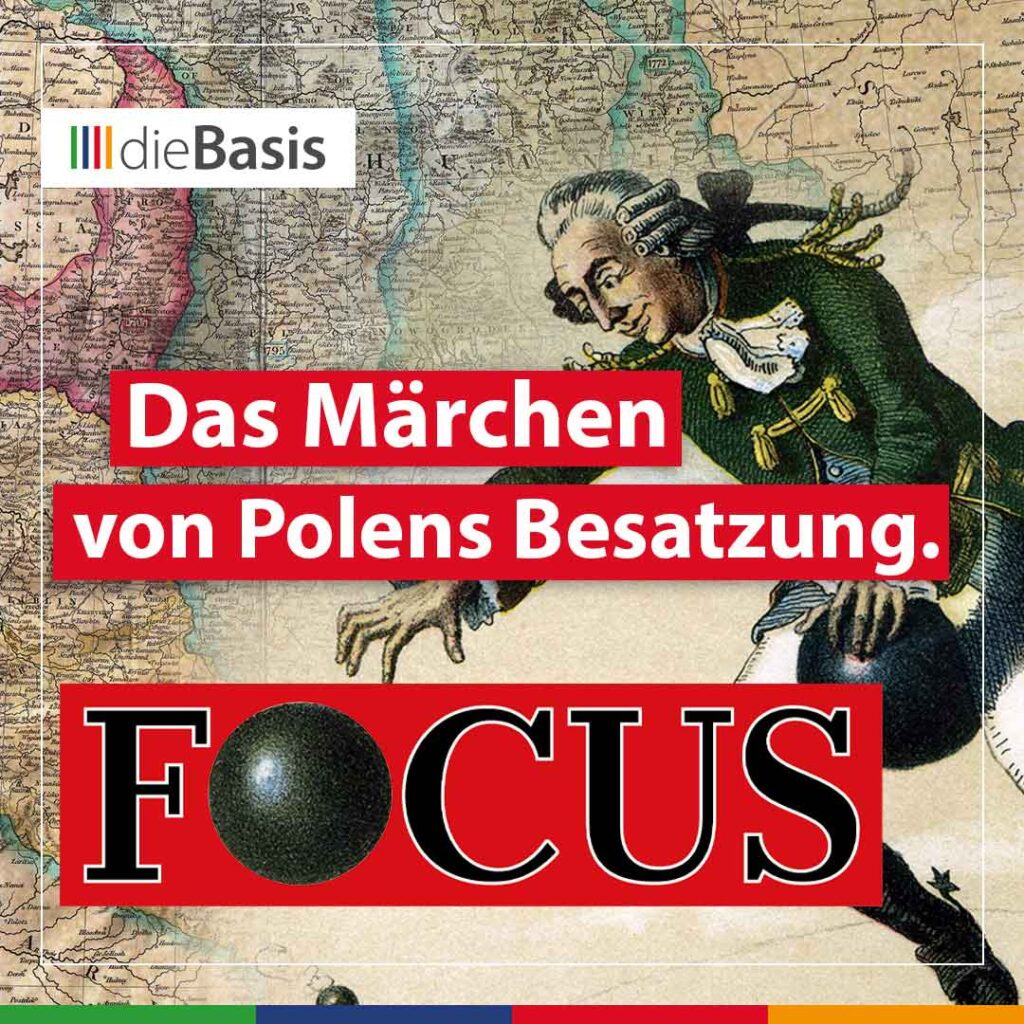
Der FOCUS-Online-Artikel „Historische Ängste treiben Polens Politik“
Unter der Zwischenüberschrift „Historische Ängste treiben Polens Politik“ heißt es wörtlich:
„Die Geschichte spielt eine wichtige Rolle in Polens Sicherheitsstrategie: Das Land hat über Jahrhunderte unter russischer Besatzung gelitten, zuletzt während des Kalten Krieges.“
Historischer Hintergrund in Kürze
Der polnische Staat formiert sich im 10. Jahrhundert. 966 lässt sich Herzog Mieszko I. taufen, ein Ereignis, das als politisch-religiöse Grundlegung des polnischen Gemeinwesens gilt.
Seit dem 16. Jahrhundert entsteht durch die Lubliner Union (1569) die polnisch-litauische Adelsrepublik, eine der größten Mächte Europas.
In den Jahren 1772, 1793 und 1795 wird Polen in drei Teilungen von Russland, Preußen und Österreich zerschlagen. Der Staat verschwindet bis 1918 von der Landkarte. In den jeweiligen Teilungsgebieten etabliert sich die Herrschaft der drei Mächte, begleitet von Russifizierung (im Zarenreich), Germanisierung (in Preußen/Deutschland) und – im Vergleich – stärkerer Autonomie in der österreichischen Provinz Galizien.
1918 kehrt Polen als Zweite Republik zurück. 1939 greifen Deutschland und – gestützt auf den Hitler-Stalin-Pakt – die Sowjetunion an und teilen das Land erneut.
Welche Herrschaften gelten als besonders repressiv?
Nach 1831 und 1863 werden Verfassung, Sejm und Armee abgeschafft. Die Russifizierung und Militärdiktatur prägen die Herrschaft.
Neben dem allgemeinen Kulturkampf gegen den Katholizismus betrieb Preußen in den polnischen Provinzen eine systematische Germanisierung, u. a. ab 1886 über die Ansiedlungskommission.
Nach 1867 erhält Galizien von Österreich weitgehende administrative Autonomie. Im Vergleich zur Politik Russlands und Preußens war der Spielraum für polnisches politisches und kulturelles Leben größer.
Die Besatzung Polens 1939 bis 1945 gilt als außergewöhnlich brutal. Ziel war die Zerschlagung des polnischen Staates, die Vernichtung der jüdischen Bevölkerung (Holocaust) und die planmäßige Unterdrückung und Eliminierung der polnischen Eliten. Begleitet wurde dies von Massenterror, Zwangsarbeit, Ghettos und Vernichtungslagern. Seriöse Schätzungen nennen 5,6–5,8 Mio. getötete polnische Bürger, darunter ca. 2,7–2,9 Mio. polnische Juden.
In Ostpolen kam es durch die Sowjetunion zu Massenverhaftungen, Deportationen in den Osten („Sondersiedlungen“, Gulag) und zur Erschießung von rund 22.000 polnischen Offizieren und Beamten (Katyn-Mord 1940). Es gibt Schätzungen, die von etwa 1,5 Mio. Deportierten in den Jahren 1940/41 sprechen.
Was der FOCUS-Artikel ausblendet
Der Artikel reduziert Polens historische Traumata auf die russische Besatzung und blendet damit zwei entscheidende historische Linien aus.
Erstens wird die deutsche Herrschaftstradition in den polnischen Teilungsgebieten und die NS-Besatzung von 1939 bis 1945 mit ihrem Vernichtungscharakter vollkommen ausgeblendet. Zweitens unterschlägt er die deutsche Mitverantwortung an der sowjetischen Besetzung aufgrund des Hitler-Stalin-Pakts.
Nur mit einer historisch ausgewogenen Darstellung würde aus einer eindimensionalen „Russland-Erzählung“ eine differenzierte deutsch-sowjetische Verantwortungsgeschichte. Dass der FOCUS-Artikel dies verschweigt, verengt die politische Perspektive, gerade weil der Artikel die aktuelle polnische Aufrüstung mit „historischen Ängsten“ begründet.
Warum solche Auslassungen gefährlich sind
Politische Meinungsmache funktioniert nicht nur über falsche Behauptungen, sondern ebenso über das Auslassen relevanter Fakten. Wer heute nur auf die „russische Besatzung“ zeigt und die deutsche Verantwortung und die gemeinsame Aggression von 1939 verschweigt, betreibt ein Framing, das kurzfristigem Deutungsgewinn dient, aber langfristig die historische Urteilskraft zerstört. Demokratien brauchen komplexe Wahrheiten und nicht selektive Narrative. Das gilt erst recht, wenn Medien Sicherheits- und Aufrüstungsdebatten führen. Dies erinnert an die Technik, die literarisch durch das Vorgehen des „Wahrheitsministerium“ in George Orwell Roman 1984 beschrieben wurde.
Fazit
Wer Polens Gegenwartspolitik erklären will, muss die gesamte historische Erfahrung Polens berücksichtigen – die deutsch-sowjetische Doppelgewalt von 1939/40 ebenso wie die längere Geschichte russischer, preußisch-deutscher und österreichischer Herrschaft. Alles andere ist selektiv und damit keine Aufklärung, sondern Framing.
Links
„Das ist unser Krieg“: Polen rüstet auf und wappnet sich mit Mega-Armee gegen Putin