Beitrag vom Fachausschuss Basisdemokratie Bayern, Christoph Ulrich Mayer
Mitgliederbefragungen der Partei dieBasis zeigen, was Basisdemokratie heute wirklich bedeutet – und warum viele sie als Alternative zum etablierten Politikbetrieb sehen.
Kurzfassung & Methode
Die folgenden Aussagen beruhen auf mehreren Mitgliederbefragungen (2.515 Teilnehmer) der Partei dieBasis. Ausgewertet wurde mit Systemischem Konsensieren (SK): Mitglieder geben je Aussage ihren Widerstand auf einer Skala von 0 (kein Widerstand) bis 10 (maximaler Widerstand) an. Daraus wird die Akzeptanz berechnet (100 % minus Ø-Widerstand×10). Beispiel: 90 % Akzeptanz = Widerstand 1. So wird messbar, wie breit tragfähig eine Position ist – nicht, wie knapp sie eine Mehrheit holt. Die Langversion des Artikels steht unter dem Beitrag zum Download zur Verfügung.
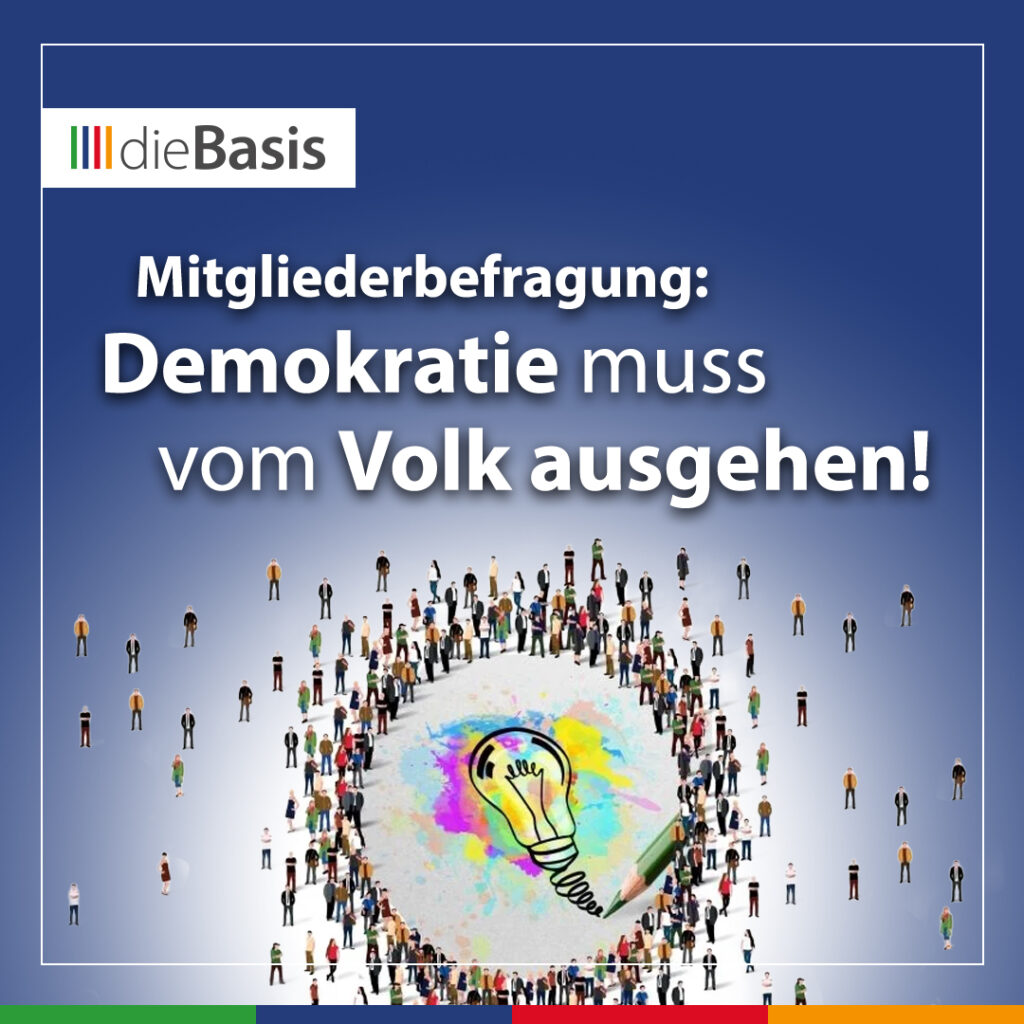
1) Warum braucht es Basisdemokratie heute? (Ergebnisse in Zahlen)
Die Top-Gründe für Basisdemokratie erreichen in der Befragung sehr hohe Akzeptanzen:
- Artikel 20 GG praktisch leben („Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus“): 97 % Akzeptanz
- Machtbegrenzung (Interessen-/Lobby-Einfluss eindämmen): 95 %
- Bürger an der Entstehung von Lösungen beteiligen (nicht nur am Ende abstimmen): 95 %
- Gute politische Kultur („unser Umgang und Miteinander weiterentwickeln“): 95 %
Integration von Perspektiven: Vielfalt als Ressource – in großen Gruppen entstehen tragfähigere, ganzheitlichere Lösungen (Schwarmintelligenz). - Selbstbestimmung („das Volk gestaltet seine Zukunft mit“): 94 %
- Korruption keinen Einfluss mehr: 94 %
- Politische Willensbildung vieler fördern: 94 %
Geringe Akzeptanz erhielten Gegenmodelle, z. B. „Einigungen erzwingen“ (≈ 55 %) oder „Einzelinteressen voranstellen“ (≈ 35 %).
Kernaussage: Die Mitglieder wollen sichtbar mehr Volkseinfluss, klare Machtgrenzen und Entscheidungen, die viele mittragen. Basisdemokratie soll Gemeinwohl organisieren, nicht die lauteste oder finanzstärkste Minderheit belohnen.
2) Wie soll Basisdemokratie funktionieren? (klar, alltagstauglich, überprüfbar)
2.1 Ein Verfahren, das Konsens belohnt
- Systemisches Konsensieren (SK) wird klar bevorzugt gegenüber Ja/Nein:
- SK-Voten: 74 % Akzeptanz
- Ja/Nein/Enthaltung: 60 % Akzeptanz
- Warum? SK misst Widerstand. Die Option mit dem wenigsten Widerstand/Bedenken ist die mit der breitesten Akzeptanz und damit für eine ganze Gemeinschaft tragfähiger.
2.2 Feste Taktung statt Endlos-Debatten
- Fixes Enddatum für Abstimmungen: 91 % Akzeptanz
- Zeiteffektive Verfahren: 84 %
- Gleichzeitig: Qualität vor Tempo bei strategischen Fragen – hohe Akzeptanz für „gründlich klären“, auch wenn es länger dauert.
2.3 Vorbereitung: kleine Gruppen, klare Rollen
- Kleine Arbeitsgruppen (Fachleute und Praktiker) sollen Themen vorbereiten: 90 % Akzeptanz
- Transparenz im Prozess: Pro/Contra-Darstellung (83–91 %), Infos auf verschiedenen Niveaus (Einsteiger + Experten + Betroffene)
- Regelmäßige digitale Befragungen: bevorzugt monatlich (85 %) oder zweimonatlich (86 %)
- Digital abstimmen: 82 %; analog abstimmen: 60 %
2.4 Diskussionskultur: klar, fair, moderiert
- Sachbezogenheit, Faktenprüfung: hohe Zustimmung
- Moderation erwünscht (Präsenz 82 %, Zoom 79 %, Chat 76 %)
- Blockadehaltungen und das Unterlaufen von Beschlüssen werden abgelehnt (z. B. „aktiv gegen Umsetzung arbeiten“: nur 19 % Akzeptanz)
- Minderheiten respektieren – Mehrheiten nicht dominieren: beides hohe Akzeptanz
2.5 Beteiligung: darf, nicht muss
- Beteiligung soll möglich, nicht Pflicht sein: „jeder darf, nicht jeder muss“
- Ich will am Entscheidungsprozess teilnehmen: 85 % Akzeptanz
- „Ich will nie abstimmen“: 1 % – also nahezu niemand
2.6 Schnittstelle zu Abgeordneten: Rückkopplung statt Fraktionszwang
Verfassungsrechtlich gilt das freie Mandat (Gewissensentscheidung). Der inhaltliche Rückkanal zur Basis wird über Transparenz organisiert:
- Abstimmverhalten offenlegen: 86 % Akzeptanz
- Abweichungen vom Mitgliederwillen begründen: 81 %
- Keine persönlichen Spenden: 89 %
- Keine bezahlten Nebentätigkeiten: 83 %
- Anwesenheitspflicht bei Abstimmungen: 88 %
Sinn: Niemand schreibt Abgeordneten vor, wie sie zu stimmen haben – aber Transparenzpflichten machen Abweichungen erklär- und überprüfbar. Das erhöht Vertrauen und Verbindlichkeit.
3) Was soll Basisdemokratie leisten? (Ziele mit Zahlen hinterlegt)
- Direkte Entscheidungen bei wichtigen Sachfragen (z. B. Volksentscheide): sehr hohe Zustimmung
- Mitwirkung an der Lösungsentstehung, nicht nur Entscheidung am Ende: 95 %
- Perspektiven integrieren (Schwarmintelligenz): 91–93 %
- Tragfähigkeit steigern (Entscheidungen, die viele akzeptieren): > 90 %.
- Selbstbestimmung & Politische Bildung verankern – z. B. eine „dieBasis Akademie“ für Methoden/Moderation/Sachkunde erreicht in mehreren Thesen 80–89 % Akzeptanz
- Informationsqualität sichern:
- „Informationen müssen verfügbar sein“: 92 %
- „neutral und nicht ideologisch gefärbt“: 91 %
- „Pro/Contra muss aufbereitet werden“: 83 %
- „Infos auf verschiedenen Niveaus bereitstellen“: 71 %
Lesart: Die Mitglieder wollen kompetente Entscheidungen – daher der Fokus auf gute Informationen, faire Verfahren, Moderation und klar dokumentierte Prozesse.
4) Basisdemokratie vs. Parlamentslogik – was unterscheidet das Modell?
- Direktheit: Häufige, themenspezifische Entscheidungen statt alle 4–5 Jahre wählen.
- Konsens statt Kante: zielt auf breite Akzeptanz, SK vermeidet 51/49-Ergebnisse, minimiert Widerstände und erhöht breites Mittragen.
- Unabhängigkeit: Regeln gegen Spenden/Nebenverdienste; Offenlegung von Verbandszugehörigkeiten (z. B. WEF) erzielte 93 %.
- Beteiligungskultur: Vorbereitende AG, digitale Tools, regelmäßige Befragungen – niedrigschwellig, freiwillig.
- Subsidiarität: Was lokal/basisnah entschieden werden kann, soll dort entschieden werden, ggf. mit transparenter Delegation und Rückkopplung.
Zusammenfassung: Das Modell versteht sich neben der direkten Bürgerbestimmung auch als Ergänzung und Korrektiv zur repräsentativen Demokratie – mit mehr Mitbestimmung, Transparenz und Verantwortung.
5) „Und warum wäre das besser?“ – Antworten auf die Fragen, die sich viele stellen
Bringt das wirklich bessere Politik?
Die Daten legen nahe: Ja. Wenn früh viele Perspektiven einfließen (95%), Informationsqualität gesichert ist (92/91/83 %) und Entscheidungen auf minimalen Widerstand optimiert werden (SK), steigt die Tragfähigkeit. Was viele akzeptieren, wird stabiler umgesetzt.
Funktioniert das praktisch – ist es schnell oder langsam?
Die Mitglieder wollen klare Enddaten (91 %) und zeiteffektive Verfahren (84 %). Gleichzeitig bereiten kleine Gruppen vor (90 %). Beteiligung ist freiwillig und niedrigschwellig („jeder darf, nicht jeder muss“). So halten wir die Beteiligung machbar – niemand muss alles tun („jeder darf, nicht jeder muss“).
Warum passiert nicht wieder das Gleiche wie bei anderen Parteien – Wahlversprechen vs. Wirklichkeit?
Regelmäßige Mitwirkung statt seltener Wahlen, Konsens statt knapper Mehrheiten.
Es gibt eingebaute Dämme: Transparenzpflichten für Mandatsträger (86 % Offenlegung, 81 % Begründungspflicht) und Unabhängigkeitsregeln (keine Spenden 89 %, keine Nebenjobs 83 %). Das macht Kurswechsel erklärungs- und kontrollpflichtig. Und das Wichtigste: Direkte Abstimmungen der Bürger über alle Fragen, die sie entscheiden wollen.
Bremsen Minderheiten nicht alles aus?
Nein. Das Verfahren belohnt nicht die lauteste Minderheit, sondern die Option mit dem geringsten Gesamt-Widerstand. Zugleich sind Blockadehaltungen und das Unterlaufen von Beschlüssen klar abgelehnt (nur 19 % Akzeptanz).
Wie schützt das Modell vor Extrempositionen?
SK misst Widerstände: Optionen mit hohem Gegenwiderstand fallen durch. Prozessnormen (Moderation, Faktenbasis, Pro/Contra-Transparenz) stabilisieren zusätzlich.
Ist das nicht zu komplex?
Komplexität wird verteilt: AGs bereiten vor, Informationen werden stufenweise aufbereitet (Einsteiger + Betroffene + Experten + unabhängige Wissensträger), Moderation ist erwünscht. So bleibt es verstehbar – und alle können mitgehen.
Wie viel Zeit kostet das?
Der bevorzugte Rhythmus ist monatlich oder zweimonatlich. Das ist regelmäßig, aber nicht überfordernd. Wer mehr geben will, arbeitet in AGs; wer weniger Zeit hat, beteiligt sich an den Abstimmungen – ohne Verpflichtung.
Wer entscheidet am Ende?
Die Bürger und die Mitglieder, mithilfe von SK und digitalen Voten. Delegation ist möglich, aber transparenzgebunden; Abgeordnete begründen Abweichungen vom Mitgliederwillen.
6) Vom Prinzip zur Praxis: das Bürgerkabinett
Aus den Befragungsergebnissen ist eine konkrete Struktur erwachsen: das Bürgerkabinett mit der basisdemokratischen Koordinationsraum-Struktur .
- Es spiegelt die Themenfelder (analog zu Ministerien)
- Kontinuierliche Beteiligung statt bloßer Wahlakte
- Basisdemokratische Selbstorganisation in thematischen Bereichen (analog zu Ministerien)
- Bürger und Mitglieder bringen Anliegen ein, arbeiten Alternativen aus und stimmen diese konsensorientiert ab (SK)
- Regelmäßige Umfragen machen den Bürgerwillen sichtbar
- Die Ergebnisse sollen Druck der Bürger auf Politiker aller Parteien ausüben und dienen als Leitlinie für Mandatsträger der Partei (sofern vorhanden)
Damit liegt eine konkrete Umsetzung der Befragungsergebnisse vor: Basisdemokratie bleibt nicht Theorie, sondern wird durch Prozesse und Strukturen umgesetzt und gelebt.
7) Fazit
Basisdemokratie nach diesen Befragungen bedeutet: Bürger entscheiden (direkte Demokratie) und wirken in jeder Phase der Lösungs- und Entscheidungsfindung mit. Prinzipien: Früh einbinden, gut informieren, fair moderieren, transparent entscheiden – und so Lösungen finden, die viele tragen. Genau das wollen die Mitglieder – und genau das erhöht die Chance auf bessere, stabilere Politik.
Hinweis zu den Zahlen: Alle Prozent- und Akzeptanzangaben stammen unmittelbar aus den dokumentierten SK-Auswertungen der dieBasis-Mitgliederbefragungen (Handout/Präsentation).
Weiterführende Inhalte & Download
- Langversion des Artikels: https://diebasis-partei.de/wp-content/uploads/2025/10/Mehr_Demokratie_als_der_Bundestag_Was_Basisdemokratie_sein_soll.pdf
- Präsentation Mitgliederbefragung 2024 mit allen Ergebnissen (PDF-Handout)
- Werte-Artikel (ergänzt das Demokratie-Profil): „Werte. Mut. Mitbestimmung. Was dieBasis-Mitglieder wirklich bewegt“.
- Bürgerkabinett (Mitwirkungsstruktur) und Satzung/Präambel (Rahmen)